Ursula Demitter aus Potsdam ist 67 Jahre alt, lebte und arbeitete in der DDR. Unter anderem bei der DEFA. Heute gibt sie Nachhilfeunterricht und schreibt hin und wieder ihre Erinnerungen von damals in Textdokumente. Da ich ohnehin ein großes Interesse an DDR-Biografien des Alltags habe und möchte, dass derartige Erinnerungen nicht auf irgendwelchen Festplatten verschimmeln und irgendwann einfach den Tod einer Festplatte sterben, packe ich die Texte von Ursula ab jetzt hier in unregelmäßigen Abständen rein. Ihr erster Text sammelt Erinnerungen aus ihrer Kindheit.

(Foto: Richard Peter, unter CC von Deutsche Fotothek)
Meine früheste Erinnerung liegt kurz bevor ich drei wurde. Unsere Oma gratulierte meiner Kusine zum achten Geburtstag.
Wir waren immer zu viert: Meine vier Jahre ältere Schwester Helga, mein drei Jahre älterer Bruder Jörg, die Kusine Edeltraut und ich, das Urselchen.
In meiner Erinnerung lungerten wir an diesem Tag im Treppenhaus herum und wussten nichts rechtes mit uns anzufangen. Es muss ein Sonntag gewesen sein, sonst hätten die größeren Kinder in die Schule gehen müssen. Unsere Familie wohnte in der Mittelstraße im Potsdamer Holländerviertel.
In der kleineren Wohnung links des Flures wohnte Oma Anna mit Opa Eduard. Wir hatten in der Mitte eine lange schmale Küche, deren Fenster zur Straße lag. Daneben gab es eine großes Wohnzimmer in dem auch meine Eltern auf je einer Couch schliefen. Im Zimmer dahinter befand sich unser Schlafzimmer. Meine Geschwister schliefen im Ehebett der Eltern. Ich schlief die ersten Jahre in einem Gitterbett, später zog ich ins Ehebett um und mein Bruder bekam eine Couch die quer zu unseren Füßen stand. Diese Liegestatt war so stramm gepolstert, dass sie sich nach oben wölbte, wenn keiner darauf lag. Wir nannten sie deshalb „den Walfisch“.
Während die Leute in den anderen Häusern der Straße noch Plumsklosetts hatten, besaßen wir eine richtige Toilette mit Wasserspülung. Mein Vater der Klempnermeister war, hatte für seine Familie diese Annehmlichkeit gebaut. Es war einfach ein Bretterverschlag vom Treppenhaus abgeteilt worden. Da ich noch ziemlich klein war und auf dem Weg zum Klo oft den Lichtschalter nicht fand, kam es vor, dass ich im Dunkeln hin und wieder die Treppe heruntergefallen bin. Das gab natürlich ein Heidengebrüll.
Überhaupt hatte ich ziemlich früh herausgefunden, was man mit Brüllen alles bewirken konnte. Wenn es Streit gab oder ich fand, dass die Älteren mich schlecht behandelten schrie ich aus Leibeskräften. Kam dann ein Erwachsener und fragte nach dem Grund, sagte ich scheinheilig:“ Ich bin nur hingefallen.“ Zum Dank dafür, dass ich nicht gepetzt hatte, mussten die Großen mich nun mitspielen lassen oder mich auf ihre Abenteuer rund um die Häuserblock mitnehmen, was sie auch taten.
In unsere Küche gab es einen Gasdurchlauferhitzer, so dass wir immer warmes Wasser hatten. Kam ich abends vom Spielen nach Hause, musste ich zum Waschen auf einen Hocker steigen, nacheinander einen Fuß ins Waschbecken setzen und dann schrubbte meine Mutter meine Knie mit einer Bürste, manchmal sogar mit Bimsstein.
In unserer Küche gab es eine Gaslampe. Mein Vater hatte diese zusätzliche Lichtquelle eingebaut, weil es zu dieser Zeit sehr oft Stromsperre gab. Dann war die ganze Straße dunkel, nur in unserer Küche brannte munter ein helles sehr weißes Licht. Die Gaslampe durften nur Erwachsene anzünden. Der Mechanismus funktionierte mit einem sogenannten „Strumpf“. Das war eine Art längliches Säckchen aus nichtbrennbarem Material. Daran hielt man ein Streichholz, drehte den Hahn auf und – flup gab es Licht. Den Gasstrumpf durfte man nicht berühren, dann fiel er in sich zusammen. Das war dann eine große Untat, denn der Gasstrumpf musste für viel Geld aus Westberlin geholt werden.
Oft saßen wir bei Stromsperre in der Küche, hatten Kerzen angezündet und meine Eltern sangen mit uns Volkslieder, damit wir am Tisch sitzen bleiben sollten und in der dunklen Wohnung nichts kaputt machen konnten. Man wusste nie, wie lange die Stromsperre dauern würde. Mal war es eine halbe Stunde, mal waren es zwei. Wenn dann plötzlich das Deckenlicht wieder anging und uns in seiner ungewohnten Helligkeit fast blendete, jubelten alle laut .
In Potsdam war eine große Zahl der sowjetischen Streitkräfte stationiert. Man sollte sich als Kind vor ihnen in acht nehmen und sich möglichst von ihnen fern halten. Auch sollte man von niemandem etwas annnehmen. Es wurde behauptet, manche wollen die Kinder vergiften. Die Nachbarsfrau, die Straßenbahnschaffnerin im Schichtdienst war, musste immer über den Bassinplatz rennen, damit sie keiner wegfangen konnte – oder so ähnlich. Mir wurden diese Geschichten nicht wirklich erzählt, aber mitbekommen habe ich sie schon.
Einmal führ ich mit meiner Schwester in der Straßenbahn. Es waren uralte klapprige Wagen mit einem hinteren offenen Perron. Ein großer dicker russischer Offizier wurde auf mich aufmerksam. Er griff in die Tasche, holte ein großes Stück Zucker heraus, das in ein Banderole eingewickelt war und hielt es mir hin. Ich machte mein finsterstes Gesicht, schüttelte heftig den Kopf und verschränkte meine Arme auf dem Rücken. Der Russe lachte, drückte meiner Schwester den Zucker in die Hand und sagte: “Gieb.“ Zu Hause wurde der Vorfall heftig diskutiert und ich hatte natürlich alles falsch gemacht.
Als die DDR gegründet war, wurde es politisch lebendig in unserer Straße. Während wir beim Abendessen saßen, kamen schon mal zwei „Aufklärer“ in unsere Küche und erklärten uns die neue Zeit. Niemand sollte nach West-Berlin fahren und dort sein Geld in Westgeld umtauschen. Nur weil es dort „Wuggi-Wuggi- Schuhe mit dicken Kreppsohlen gab. Darauf sollten wir verzichten, denn das schädigt unseren jungen Staat. Meine Mutter sagte nichts, aber in solchen Momenten sah sie immer aus, als hätte sie Zahnschmerzen.
Noch schlimmer fand sie den Stadtfunk. Noch immer hatte nicht jeder Haushalt ein Radio. Die hatte man beim Einmarsch der Russen unter Androhung schlimmster Strafen , alle abgeben müssen. Also bekamen wir nach russischer Sitte einen Stadtfunk.
Schräg gegenüber von unserem Haus befand sich an der Ecke Mittelstraße/Benkertstraße die Gasstätte „Zum Fliegenden Holländer.“ Die gibt es dort heute noch.
Jeden Sonntag früh um sieben plärrten aus dem Lautsprecher in übelster Tonqualität alle möglichen Kampflieder. Am häufigsten wurde gespielt: „Spaniens Himmel breitet seine Sterne..“ Auf diese Art habe ich das Lied sehr schnell gelernt. Aber meine Mutter knurrte irgendwas von „unmöglichem Lärm..“ und schloss wütend die Fenster.
Mein Vater hatte ein Auto. Das war was ganz besonderes. Alle privaten Autos hatte man entweder in den letzten Kriegstagen an Hitler – oder nach dem achten Mai an die Russen übergeben müssen. Dennoch: Mein findiger Vater hatte schon kurz nach dem Krieg, es mag 46 oder 47 gewesen sein, wieder ein Auto. Das ist eine spezielle Geschichte, ein Abenteuer und reichlich kriminell.
Es war die Zeit der allgemeinen Hamsterei. Alle aus der Stadt fuhren aufs Dorf und verhökerten was irgend einen Wert hatte an die Bauern : Für Essbares. Mein Vater hat solche Fahrten für Bekannte und Freunde erledigt. Es war gefährlich, weil verboten. Aber es fiel immer was ab.
Wir hatten als Familie das Glück, dass wir bäuerliche Verwandte in den havelländischen Dörfern hatten. Von dort bekamen wir zu Essen. Es war nicht viel, aber schon ein Sack Kartoffeln war damals ein unschätzbarer Wert. Die neue Administration stellte überall kurz geschulte Hilfspolizisten ein. Zwischen den Landkreisen waren Kontrollen eingerichtet. Man wollte die Bauern zwingen, alles abzuliefern und durch die Verwaltung gelenkt, der hungernden Bevölkerung gerecht zukommen zu lassen. Das funktionierte natürlich nicht, denn wo ein Mangel ist, da ist kriminelle Energie. Ich erinnere mich, wie wir an einem Sonntagabend von den Verwandten im Dorf Roskow, 12 km von Brandenburg entfernt, nach Hause, nach Potsdam, aufbrachen. Mein Vater besaß einen alten Aero, eine Automarke, die es heute nicht mehr gibt. Es war ein Lieferwagen mit langem Heck. Vor der Abfahrt wurde ein Sack Kartoffeln auf die Ladefläche geschüttet. Darauf wurden Decken gelegt. Dann mussten wir drei Kinder uns darauf legen. Es wurde uns eingeschärft: „Wenn ein Kontrolle kommt, müsst ihr fest schlafen, ihr dürft die Augen nicht öffnen. Und genau das passierte. Die Hilfspolizisten leuchteten mit Taschenlampen in das Auto. Da lagen drei Kinder und schliefen tief und fest. Man verzichtete darauf, das Auto weiter zu untersuchen und so brachten meine Eltern ihre Konterbande sicher nach Hause.
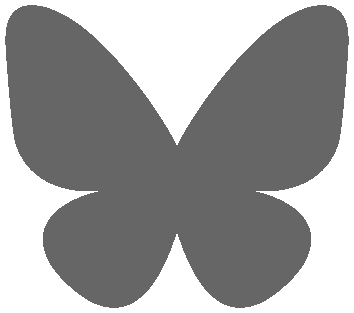


Das Foto ist überragend!
schöne erinnerungen niedergeschrieben – da läuft das kopfkino ; )
Genial, freue mich auf weitere Erinnerungsgeschichten.
Geniales Foto! Der Charme einer Straße ohne Autos.
Es ist sehr schön diese Geschichte aus meiner Heimatstadt hier zu lesen. Danke.
Sehr geil ich feiere Ursula hier , freu mich schon auf mehr Texte von ihr.Vielen Dank und ein schönes Wochenende .
Tolle Geschichten und schön erzählt. Ich freu mich auf die nächsten Episoden. Ein herzliches Dankeschön auch an Frau Demitter